Nachdem der Pfad den ganzen Tag langsam und stetig angestiegen war, ging es plötzlich in steilen Serpentinen bergab. Ein großer Teil des Weges verlief durch ein jetzt im Herbst ausgetrocknetes Flussbett. Auf halben Weg öffnete sich der Wald plötzlich, und in den Fels verankert stand ein großes, hölzernes Kreuz. Ich konnte aus großer Höhe mein Ziel sehen, die Kirche und die am Hang stehenden Häuser der Skete und auch den kleinen Hafen der Siedlung. Das Schnellboot von Ouranopoli zog gerade eine schäumend weiße Linie durch das tiefe Blau. Der Anblick war überwältigend. Steile, felsige Berghänge zuoberst, dann das tiefe Grün der sich seit tausend Jahren selbst überlassenen Natur. Die Kreuzkuppelkirche aus hellem Stein ragte hervor und man sah den großen, steinernen Balkon, von dem man einen überwältigenden Blick auf das Meer haben musste und die mit schweren Steinziegeln gedeckten Dächer des Gästehauses daneben. Man konnte vereinzelt die schmalen Wege zwischen den Häusern ausmachen, und noch weiter unten sah man die auf Terrassen angelegten, in Reih und Glied stehenden Olivenbäume. Man konnte Zitronen-, Orangenbäume und Walnussbäume erahnen. Jedes Luxusresort auf der Welt musste die Skete für diese überwältigende, atemberaubende Lage und die Kulisse beneiden, und könnte das Land hier mit allem Geld der Welt kaufen gekauft werden, würden hier sicher längst die Reichsten der Reichen Ihren Urlaub verbringen.
Hier war es auch, als unvermittelt Nikolaus neben mir stand und auf die Skete zeigte und begann, mir in einer kaum zu bändigenden Wortfolge von der Siedlung und dem Athos zu erzählen und allerlei Fragen zu stellen. Als er erfuhr, dass ich aus Deutschland käme, mischte er den griechischen und englischen noch einige deutsche Worte hinzu. Er war in diesem Jahr sechzig Jahre alt geworden und hatte einmal in Düsseldorf und Köln gearbeitet, vor beinahe vierzig Jahren, in einem Blumenladen. (Gefühlt haben fast alle Leute, die wir in Albanien und Griechenland getroffen haben und die nur einige Worte oder auch fließend Deutsch sprachen, einmal in Deutschland gearbeitet, und fast ausnahmslos war es in Düsseldorf gewesen.) Aus Achen und den Niederlanden hatte er die Blumen in einem alten Mercedes-Transporter herbei gefahren, und das alte Radio sei von der Firma Becker gefertigt gewesen. „Very strong Radio – Becker!“ sagte er immer wieder, auf meinen Nachnahmen anspielend. Er war einer jener Männer, denen das fortgeschrittene Alter kaum einen Deut ihrer ursprünglichen, jugendlichen Kraft geraubt hatte. Gleich fragte er mich, woher ich gekommen sei und wollte wissen, ob an einer Stelle auf halbem Wege, von der ich nicht deuten konnte, welche er meinte, der Bach über sein Ufer träte? Im Frühling wäre das Wasser dort reißend. Kaum hatte er mich gefragt, ob wir den Rest des Weges gemeinsam zurücklegen würden, er kenne einen der Mönche in der Skete und dort würden wir Raki bekommen, da war er schon los gelaufen. Also schulterte ich schnell meinen schwer gewordenen Rucksack und hastete ihm hinterher. Er war ein Quell von überbordender Energie, und ständig in Bewegung. Mal hob er einen Stein auf und beschwerte sich über den Pfad, der vom Wasser ausgespült und nicht wieder befestigt worden war, dann warf er ihn fort und stampfte auf die Stufen, um seinen Punkt zu verdeutlichen. Immer wieder sagte er „Monopáti!“ und erklärte mir sämtliche Wege zwischen den Klöstern, sprach von einer Hütte auf einem Berg in Zentralgriechenland, von der Zubereitung von Kartoffeln, von seinem Sohn, der in London arbeitete, dann wieder fand er einige Sträucher am Rande des Weges und ließ sie mehrfach durch die Hände laufen, um dann daran zu riechen und rief aus „Ároma!„, während er tief die Luft durch die Nase einsog. Er erklärte mir, er würde seit 40 Jahren auf den Berg kommen, meist mehrere Male im Jahr und beschrieb mir jede Veränderung des Weges im Laufe der Jahrzehnte. Dabei kritzelte er mit seinem Stock Worte und Zahlen in den Boden. Das Problem daran war, dass seine ununterbrochenen Wortfolgen zum größten Teil aus griechischen Worten bestanden und nur jedes zehnte Wort ein deutsches oder englisches war. Immer wieder fragte er mich dann „Do you understand, Becker?“ (Mit meinem Vornamen tat er sich schwer und irgendwann gab ich es auf.) Zwar verstand ich wenig, aber eigentlich war das kein Problem. Wir redeten einfach weiter und erzählten uns verschiedenste Dinge und Begebenheiten, wobei Nikolaus den weitaus größeren Teil davon sprach, während ich versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Einmal rutschte er aus und fiel halb auf die Knie, halb auf den Hosenboden und blieb so eine Weile ohne eine Regung in dieser verdrehten Position sitzen. Ich eilte herbei und fragte, ob alles in Ordnung wäre und machte mir ein wenig Sorgen, doch dann stand er unvermittelt auf, schimpfte über den Weg – „Monopáti, pah!“ – und stapfte weiter. In der Skete angekommen, führte er uns sogleich zu seinem Freund, noch einmal zehn Minuten steile Stufen hinauf. Ich war eigentlich bedient von der langen Wanderung, aber ich hatte keine andere Wahl. Zu allem Überfluss war sein Freund nicht da, aber davon ließ sich Nikolaus nicht aufhalten. Ein weiterer Mönch ließ uns schließlich ein wenig skeptisch ein und so kamen wir auf der Terrasse des Hauses mit atemberaubendem Blick über die steilen Hänge und die Ägäis in den zweifachen Genuss des obligatorischen Rakis, von griechischem Kaffee und der klebrigen Süßigkeit.
Die Skete der heiligen Anne – von Wundern & Erlösung
Eigentlich musste ich mich von nun an um nichts mehr kümmern, Nikolaus hatte das Kommando übernommen. (Wenn ich es richtig verstanden hatte, war er einst bei der Armee, nun aber pensioniert.) Er zeigte mich umher, seinen neuen Freund aus Deutschland, führte mich über die engen Pfade der Siedlung, zeigte mir eine schmale Höhle, in der einst ein Einsiedler gelebt hatte, erklärte mir die steinerne, längst nicht mehr in Gebrauch befindliche Vorrichtung zum Pressen von Oliven, die wir am Wegesrand gefunden hatten und deutete auf die schweren, dunklen Dachbalken eines Unterstands, den wir fanden. Die Balken seien aus Kastanienholz und würden das Dach noch eine Ewigkeit tragen. Er war es auch, der mich, zurück auf dem großen, steinernen Balkon zwischen Kirche und Gasthaus der Skete, in den kleinen Laden drängte. Ich musste unbedingt eine Halskette und ein Armband kaufen, um es von einem Priester segnen zu lassen. Dazu erzählte er mir allerlei wundersame Geschichten über die Kräfte des Heiligen, deren Inhalt ich nur erahnen konnte, und schob mich in die Kirche und in die Arme des Priesters. Ich bekreuzigte mich etwas ratlos, verbeugte mich und übergab Armband und Halskette. Der Priester bemerkte wohl meine Unbeholfenheit und fragte Nikolaus etwas, der nur kurz antwortete, ich sei aus Deutschland und „Katholik.“ Ich beließ es dabei. Dann murmelte der Priester etwas, öffnete eine große Schatulle, zeichnete mit meinen neu erworbenen Schmuckstücken drei Kreuze in die Luft und berührte die blecherne Vorrichtung mehrfach an einer Stelle, an der eine Art Luftschlitze eingelassen waren. Offenbar befand sich in der Schatulle eine wichtige Reliquie, mit übernatürlichen Kräften. Als ich mich bei Nikolaus für die von ihm initiierte Segnung der Glücksbringer bedanken wollte, lachte er nur und schüttelte mit dem Kopf, als hätte ich etwas Unerhörtes gesagt. Scheinbar wollte er mit der Ehre nichts zu tun haben, schließlich hätte ich die Segnung von einem Priester erhalten und sein bescheidenes, weltliches Licht hätte keinen Dank verdient.










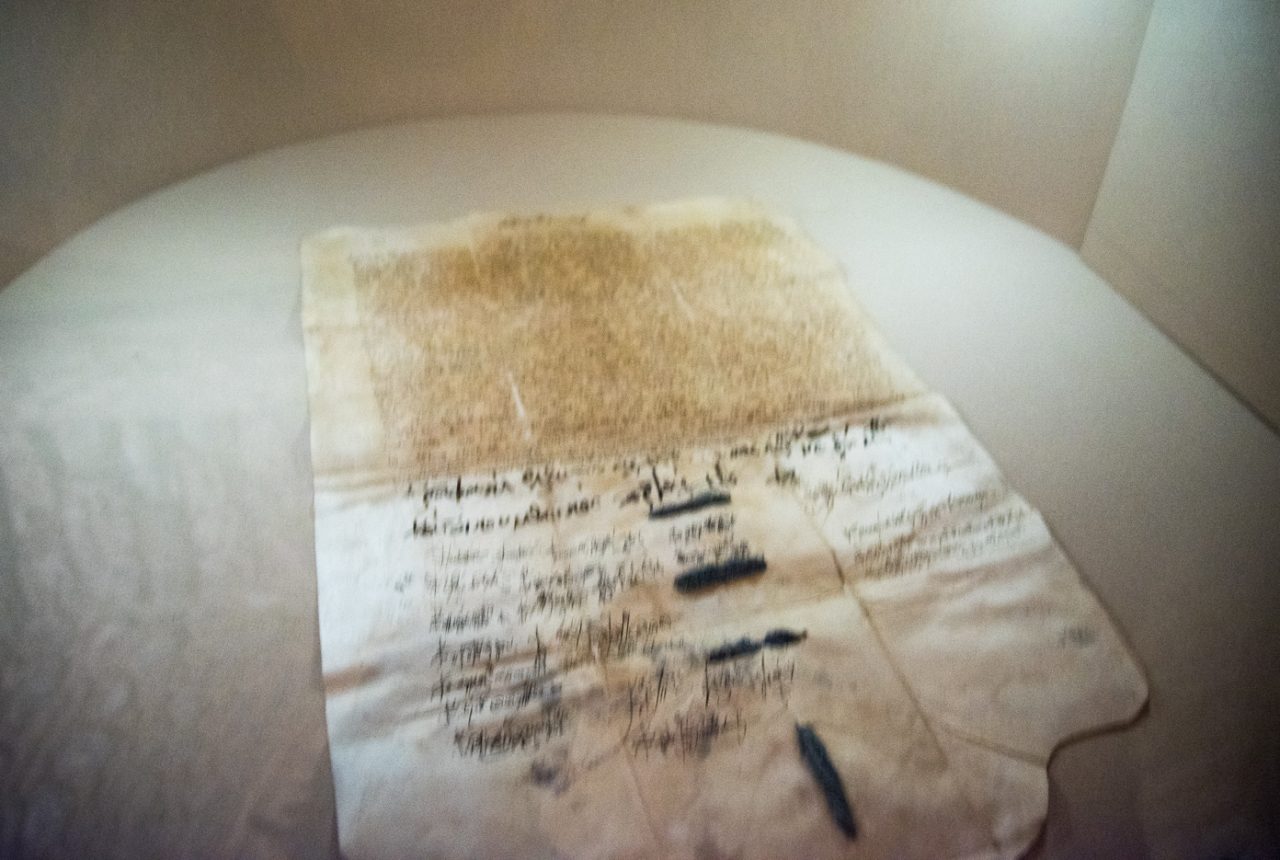



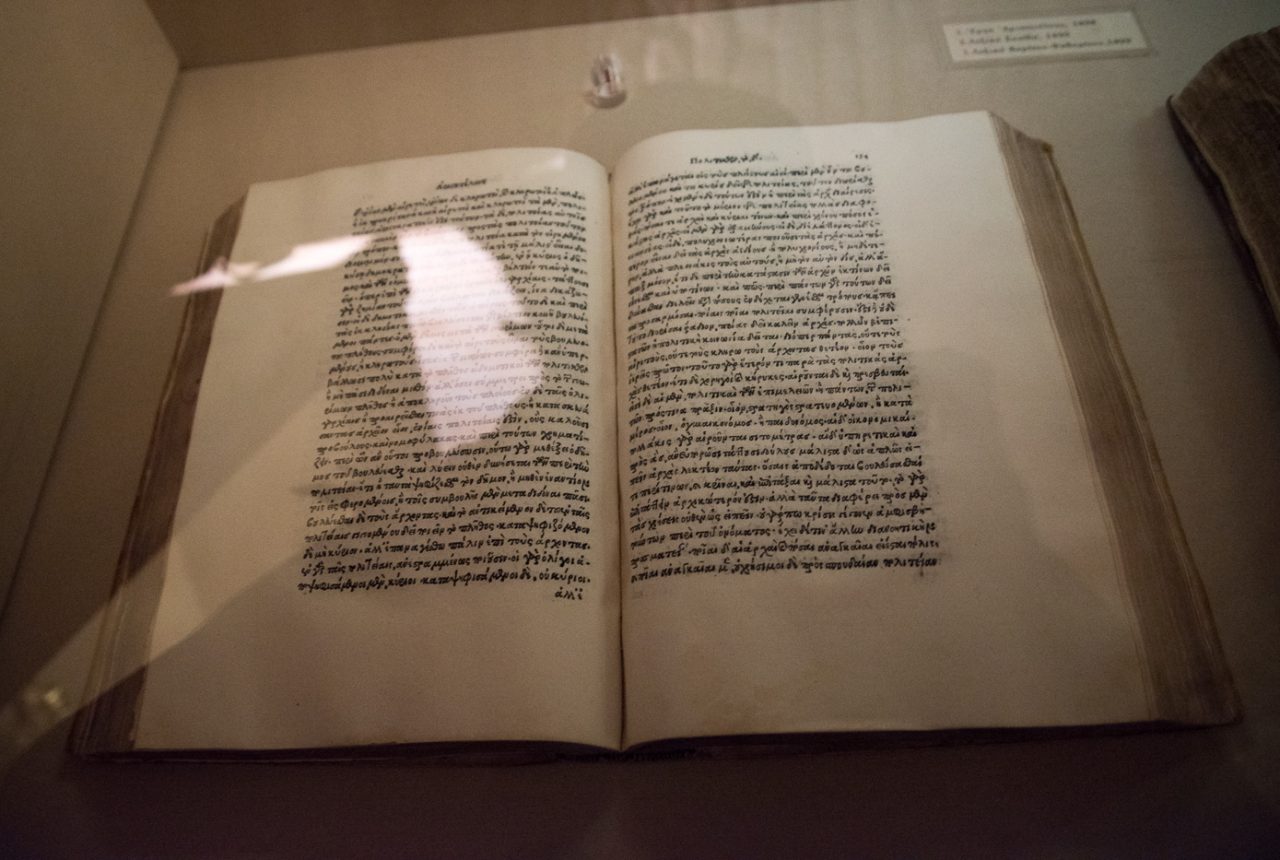















2 comments
Wunderschöner Reisebericht, habe ich mit Vergnügen und Staunen gelesen. Ich habe Athos dreimal besucht, als ich jünger war – die Erfahrungen gleichen sich. Nun plane ich einen Besuch in 2022, mit meinem Sohn.. quasi ein Abschied für mich, es wird zu beschwerlich. Ich glaube, ich werde Ihre übrigen Berichte auch lesen…